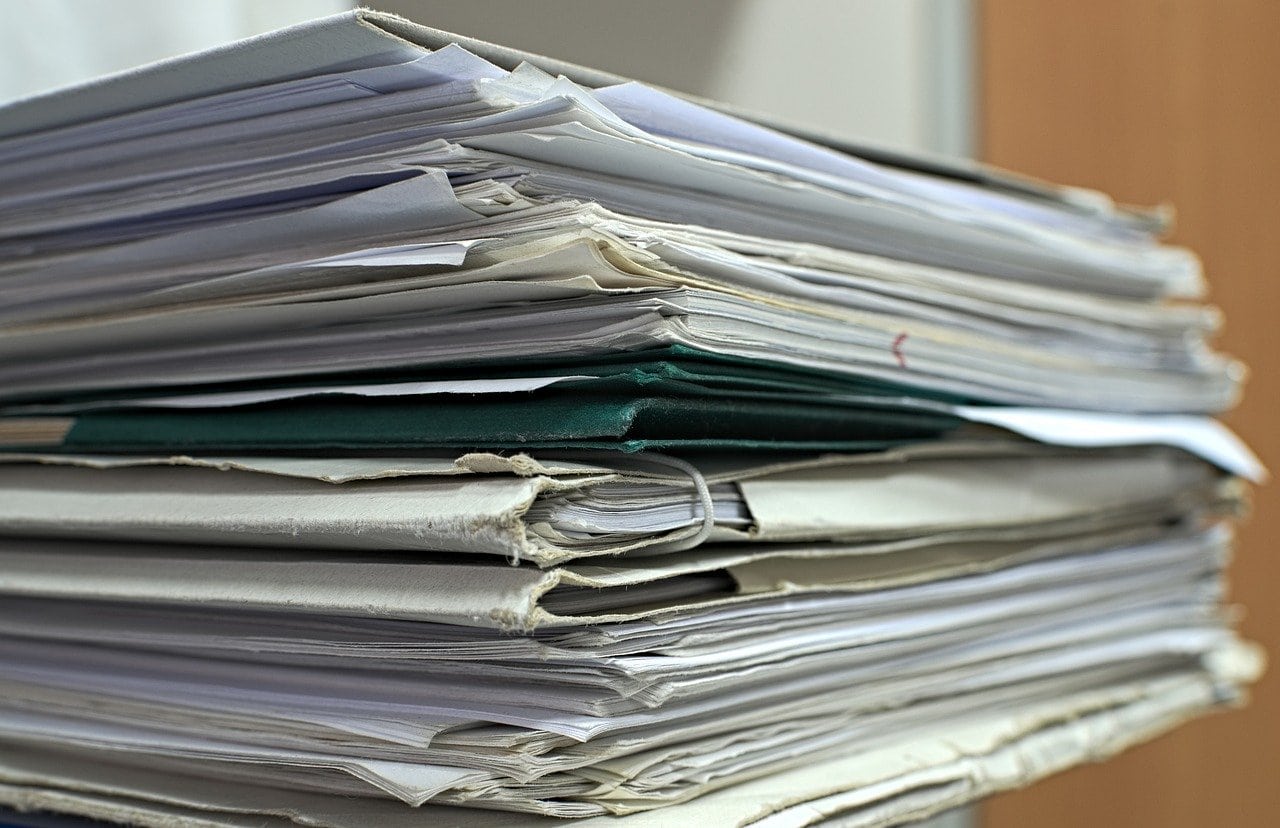Das Thema
Das deutsche Arbeitsrecht verbietet den Ausspruch einer Kündigung während einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich nicht. Die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung zur krankheitsbedingten Kündigung zeigt vielmehr, dass nicht nur der Ausspruch einer solchen Kündigung zulässig sein, sondern die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Kündigung rechtfertigen kann.
Nicht selten: “Flucht in die Arbeitsunfähigkeit” bei drohender Kündigung
In der Praxis kommt es losgelöst von Fällen krankheitsbedingter Kündigungen immer wieder vor, dass eine arbeitgeberseitige Kündigung in engem zeitlichen Zusammenhang mit einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit des gekündigten Arbeitnehmers steht. So mag beispielsweise die drohende Kündigung den Arbeitnehmer derart stark belasten, dass er tatsächlich erkrankt. Nicht selten besteht aber auch der Verdacht, dass der Arbeitnehmer dem persönlichen Kündigungsgespräch sowie der Weiterarbeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist durch eine „Flucht in die Arbeitsunfähigkeit“ aus dem Weg gehen möchte. Und schließlich gibt es Fälle, in denen Kündigung und krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit schlichtweg rein zufällig zusammentreffen.
Aktuelle Entscheidungen des Landesarbeitsgerichts Nürnberg (Urteil vom 10. Dezember 2019, Az. 7 Sa 364/18 sowie Urteil vom 04. Juli 2019, Az. 5 Sa 115/19) verdeutlichen das in diesem Zusammenhang bestehende Risiko des Arbeitgebers in Hinblick auf den Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.
Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall richtet sich insbesondere nach § 3 EFZG. Er ist dabei regelmäßig auch an den Bestand des Arbeitsverhältnisses gebunden. Der Anspruch entsteht erst nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses und endet grundsätzlich spätestens zusammen mit dem Arbeitsverhältnis.
Eine bedeutende Ausnahme von diesem Grundsatz ergibt sich aus § 8 Abs. 1 S. 1 EFZG. Danach kann der Anspruch auf Entgeltfortzahlung ausnahmsweise über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus fortbestehen. Ein Arbeitnehmer verliert den Anspruch auf das Arbeitsentgelt nämlich trotz Beendigung des Arbeitsverhältnisses dann nicht, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit gekündigt hat (sogenannte Anlasskündigung).
Liegt eine Anlasskündigung vor, ist die Kündigung zwar nicht aus diesem Grund unwirksam. Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht in einem solchen Fall jedoch unabhängig von der Wirksamkeit der Kündigung bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit, höchstens jedoch für die Dauer von sechs Wochen, fort. Die Vorschrift sichert den gesetzlichen Entgeltfortzahlungsanspruch sowohl gegenüber dem betroffenen Arbeitnehmer als auch gegenüber der Sozialversicherung ab, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis mit einem arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer aus diesem Anlass kündigt.
Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähigkeit und Kündigung: Die Bewertung des LAG Nürnberg
Die Entscheidungen des LAG Nürnbergs betrafen jeweils Fälle, in denen das Arbeitsverhältnis in einem engen zeitlichen Zusammenhang nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit gekündigt wurde. Zwischen Beginn der Arbeitsunfähigkeit und Ausspruch der Kündigung lagen wenige Tage (Urteil vom 04. Juli 2019, Az. 5 Sa 115/19) bzw. etwa zwei Wochen (Urteil vom 10. Dezember 2019, Az. 7 Sa 364/18). Ob darüber hinaus auch ein sachlicher Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähigkeit und Kündigung bestand, war zwischen den Parteien jeweils streitig.
Das LAG Nürnberg hat klargestellt, dass ein Arbeitsverhältnis „aus Anlass“ der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von § 8 Abs. 1 S. 1 EFZG gekündigt wird, wenn die Arbeitsunfähigkeit wesentliche Bedingung der Kündigung ist. Es komme auf die objektive Ursache und nicht auf das Motiv der Kündigung an. Der Begriff „aus Anlass“ sei weit auszulegen. Es genüge, wenn die Kündigung ihre objektive Ursache und wesentliche Bedingung in der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers habe und den entscheidenden Anstoß für den Kündigungsentschluss gegeben habe.
Anlasskündigung: Arbeitgeber muss Vermutung widerlegen
Darlegungs- und beweispflichtig für eine solche Anlasskündigung sei zwar der Arbeitnehmer. Dem Arbeitnehmer könne dabei aber ein Anscheinsbeweis zu Gute kommen. Eine Anlasskündigung sei zu vermuten, wenn sie in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit erfolge.
In einem solchen Fall habe der Arbeitgeber den Anscheinsbeweis durch entsprechenden Sachvortrag zu erschüttern und im Falle des Bestreitens durch den Arbeitnehmer durch entsprechenden Beweisantritt zu wiederlegen. Gelinge ihm das nicht, bleibe es bei der Vermutung einer Anlasskündigung.
Die Widerlegung der Vermutung für die Anlasskündigung ist dem Arbeitgeber lediglich in einem der beiden vom LAG Nürnberg entschiedenen Fälle gelungen (Urteil vom 10. Dezember 2019, Az. 7 Sa 364/18). Insbesondere konnte er zwei Zeugen benennen, die zur Überzeugung des Gerichtes belegen konnten, dass der Kündigungsentschluss des Arbeitgebers bereits vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gefasst und dem Arbeitnehmer sogar kommuniziert worden war. Ferner sprachen in diesem Fall weitere Umstände dafür, dass nicht die Arbeitsunfähigkeit der Anlass für die Kündigung war.
Kritik am Anscheinsbeweis
In der Literatur wird die Annahme eines solchen Anscheinsbeweises vielfach abgelehnt. Insbesondere fehle es an verifizierbaren Erfahrungssätzen für die Annahme eines solchen Anscheinsbeweises (MüKoBGB/Müller-Glöge, EFZG § 8 Rn. 18). Der zeitliche Zusammenhang könne deshalb nur als erstes Indiz dienen – komme es aber zu keiner Auflösung in Form richterlicher Überzeugung, so trage das non liquet der Arbeitnehmer, weil eine anspruchsbegründende Tatsache nicht festgestellt werden könne (ErfK/Reinhard, EFZG § 8 Rn. 10).
Das LAG Nürnberg befindet sich mit seinen Entscheidungen jedoch auf etablierten Pfaden der Rechtsprechung. So ist auch das BAG in vergleichbaren Konstellationen bereits von einem Beweis des ersten Anscheins ausgegangen (BAG, Urteil vom 05. Februar 1998, Az. 2 AZR 270/97). Auch weitere Landesarbeitsgerichte folgen der Linie einer Vermutungswirkung (beispielsweise LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 1. März 2018, Az. 10 Sa 1507/17; LAG Schleswig-Holstein, Urteil vom 6. Februar 2014, Az. 5 Sa 324/12).
Auswirkungen für die Praxis: Kündigungsentschluss sollte dokumentiert werden
Arbeitgeber können Kündigungen weiterhin während krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit oder in ihrem engen zeitlichen Zusammenhang aussprechen. Sie sollten aber darauf achten, den Kündigungsentschluss intern zu dokumentieren oder ein sonstiges geeignetes Beweismittel für den Fall einer späteren Streitigkeit zu schaffen. Dies insbesondere dann, wenn eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers bereits begonnen oder noch vor Ausspruch der Kündigung zu erwarten ist.
Dabei sollte jedoch auch darauf geachtet werden, den Bogen nicht zu überspannen. Allzu umfassende und abschließende Dokumentationen, die zur Verteidigung gegen den Entgeltfortzahlungsanspruch vorgelegt werden müssen, könnten ansonsten die Argumentationsmöglichkeiten in Bezug auf einen etwaigen erforderlichen Kündigungsgrund im Kündigungsschutzprozess unnötig begrenzen. Für den Arbeitgeber entscheidend und ausreichend ist es, nachweisen zu können, dass objektive Ursache und wesentliche Bedingung für die Kündigung nicht die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers war.
Sinnvoll ist ein solches Vorgehen im Übrigen auch, wenn der Arbeitnehmer (noch) keinen Kündigungsschutz genießt. Erstens ist der Anspruch aus § 8 Abs. 1 S. 1 EFZG unabhängig vom Kündigungsschutz zu betrachten. Zweitens kann die Dokumentation aber auch außerhalb von geltendem Kündigungsschutz kündigungsrechtlich sinnvoll sein – nämlich um im Streitfall dem Vorwurf begegnen zu können, die Kündigung sei aus diskriminierenden, maßregelnden oder willkürlichen Gründen erfolgt und deshalb unabhängig von der Anwendbarkeit von Kündigungsschutz unwirksam.