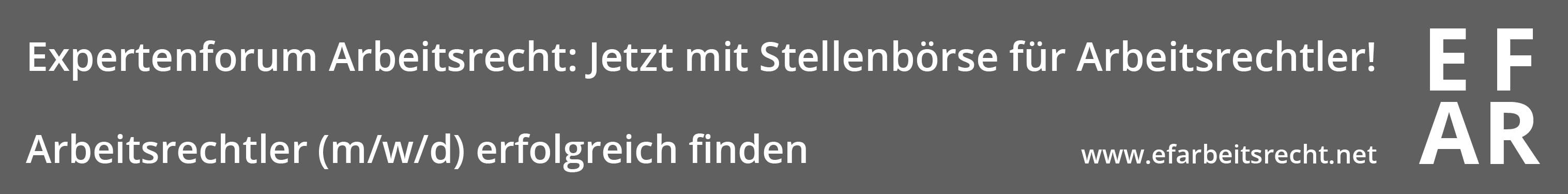Das Thema
Das Bundesverfassungsgericht hat den Gesetzgeber verpflichtet, im Personenstandsgesetz neben dem Eintrag “männlich” oder “weiblich” einen weiteren Eintrag vorzusehen für ein drittes Geschlecht.
Besteht aktuell (oder künftig) eine Handlungspflicht für Arbeitgeber zur Nachfrage, ob Mitarbeiter zum dritten Geschlecht gehören, insbesondere vor dem Hintergrund der bald geltenden DSGVO?
Das dritte Geschlecht
Nach derzeitigem Personenstandsrecht ist ein Kind im Geburtenregister entweder dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuzuordnen. Ist das nicht möglich, wird das Geschlecht nicht eingetragen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3, § 22 Abs. 3 PStG). Darin liegt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 10. Oktober 2017 – 1 BvR 2019/16) eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) und ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG). Der Gesetzgeber hat bis zum 31. Dezember 2018 eine Neuregelung zu schaffen. Es muss zumindest ein weiterer Eintrag vorgesehen werden. Bis dahin ist eine entsprechende Eintragung nach aktueller Rechtslage nicht möglich (vgl. OLG Celle, 21.01.2015 – 17 W 28/14).
Erste praktische Auswirkungen: Änderung der Stellenanzeigen
Im Nachgang zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts finden sich in jüngster Zeit zunehmend Stellenanzeigen, die den üblichen Klammerzusatz (m/w) auf (m/w/d) erweitern. Das “d” steht dabei für “divers”. Wesentlicher rechtlicher Hintergrund hierfür ist, Indizien zu vermeiden, die für eine Verletzung des Benachteiligungsverbots im Sinne des AGG sprechen können (vgl. die Beweiserleichterung des § 22 AGG). Da das Bundesverfassungsgericht eine Häufigkeit von 1:500 intersexuellen Menschen angenommen hat, erscheint das nicht als völlig übertriebene Vorsichtsmaßnahme.
Einfluss auf den Beschäftigtendatenschutz
Daneben wird die Entscheidung des BVerfG auch im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Neuregelungen Relevanz entfalten: Ab dem 25. Mai 2018 finden die Regelungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unmittelbare Anwendung auch in Deutschland. Ergänzt werden die zwingenden Vorschriften durch ein neues Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu), das zeitgleich in Kraft tritt. Die Rechtsfolgen einer datenschutzrechtlich unzulässigen Verarbeitung sind erheblich. So hat die DSGVO nicht zuletzt wegen der potentiell hohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder – sofern dies höher ist – bis zu 4% des Umsatzes der Unternehmensgruppe Aufsehen erregt. Unternehmen sind daher gefordert, die zwingenden gesetzlichen Vorgaben fristgerecht und “richtig” umzusetzen (siehe auch: Compliance – Resolutions for 2018?).
Die DSGVO enthält keine spezifischen Vorschriften zum Beschäftigtendatenschutz, sondern überlässt diese den nationalen Gesetzgebern (Art. 88 Abs. 1 DSGVO). Deutschland hat von der Öffnungsklausel Gebrauch gemacht und den Beschäftigtendatenschutz in § 26 BDSG-neu geregelt (siehe auch: Der Beschäftigtendatenschutz – Noch ein weiter Weg). Dabei bleiben die allgemeinen Grundsätze der DSGVO, insbesondere der „Eckpfeiler“ des neuen Datenschutzrechts in Art. 5 DSGVO, zwingend zu beachten.
DSGVO fordert Grundsatz der Datenrichtigkeit
Das dritte Geschlecht wirft in erster Linie Fragen in Bezug auf den Grundsatz der Datenrichtigkeit nach Art. 5 Abs. 1 d) DSGVO auf. Personenbezogene Daten müssen “sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“).”
Eine Handlungspflicht setzt einerseits voraus, dass die Daten im Sinne des Art. 5 Abs. 1 d) DSGVO unrichtig sind, andererseits das Unternehmen Kenntnis von der Unrichtigkeit hat. Da eine Kenntnis in Bezug auf das dritte Geschlecht im Regelfall nicht besteht, wird HR derzeit mit der Frage konfrontiert, ob eine aktive Pflicht zur Nachfrage besteht, um eine etwa erforderliche Korrektur vornehmen zu können.
Richtigkeit und Aktualität der Daten
Art. 5 Abs. 1 d) DSGVO geht grundsätzlich von der Pflicht zur “Richtigkeit” aus, schränkt diese jedoch hinsichtlich der notwendigen “Aktualität” eines Datums ein. „Sachlich richtig“ ist ein objektives Kriterium und bedeutet, dass die über die betroffene Person gespeicherten Informationen mit der Realität übereinstimmen (Herbst, in: Kühling/Buchner, Datenschutz-Grundverordnung, 1. Auflage 2017, Art. 5 Rn. 6).
Personen, deren Geschlechtsentwicklung objektiv sowohl männliche als auch weibliche Varianten aufweist, mögen zwar biologisch dem dritten Geschlecht zugeordnet werden können. Allerdings stellt das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 10. Oktober 2017 nicht allein auf solche objektive Kriterien ab, sondern auch auf die subjektiv gewünschte Zuordnung: “Durch die bloße Eröffnung der Möglichkeit eines weiteren Geschlechtseintrags wird niemand gezwungen, sich diesem weiteren Geschlecht zuzuordnen. Die Ermöglichung eines weiteren Geschlechtseintrags vermehrt die Optionen von Menschen mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung, die über den Eintrag als Mann oder Frau nicht abgebildet wird, ohne ihnen Möglichkeiten zu nehmen, die das Recht bislang bietet. In einem Regelungssystem, das Geschlechtsangaben vorsieht, müssen die derzeit bestehenden Möglichkeiten für Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung, sich als weiblich oder männlich oder ohne Geschlechtseintrag registrieren zu lassen, erhalten bleiben.”
Ist der vorhandene Eintrag im Personenstandsregister im Datenbestand des Unternehmens abgebildet?
Daraus kann nun nicht gefolgert werden, dass bis zu einer gesetzlichen Neuregelung allein auf die Angabe der betroffenen Person abgestellt werden muss, welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlt. Im Gegenteilt steht der subjektive Einschlag aktuell einer objektiven Nachprüfbarkeit entgegen. Ausgangspunkt kann allein eine (korrigierte) Eintragung im Personenstandsregister sein. Fragestellung ist nicht, ob der Eintrag im Personenstandsregister richtig ist (was nicht in die Beurteilungskompetenz des Unternehmens fällt). Entscheidend ist vielmehr, ob der vorhandene Eintrag im Register genauso im Datenbestand des Unternehmens abgebildet ist oder nicht. Daran ändert nichts, dass das Personenstandsregister derzeit – verfassungswidrig – keine weitere Eintragungsmöglichkeit vorsieht. Erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung handelt es sich um eine Tatsache, die einem objektiven Beweis zugänglich ist. Insofern ist zurzeit schon nicht von einem “unrichtigen” Datum auszugehen.
Erst nach einer Änderung der Gesetzeslage kann sich daher die Frage stellen, ob aktiv an Beschäftigte herangetreten werden muss. Dabei wird aber die Einschränkung in Art. 5 Abs. 1 d) DSGVO zu berücksichtigen sein, wonach Daten nur “erforderlichenfalls” auf dem neuesten Stand sein müssen, was sich nach dem Zweck der Verarbeitung richtet (z.B. Erstellung einer nach Geschlechtern getrennten Wählerliste gem. § 2 WO). Eine allgemeine Pflicht zur Umfrage besteht also auch später nicht. Daten müssen nicht ohne Anlass auf den tagesaktuellen Stand gebracht werden.
Recht auf Berichtigung
Weitere Fragen werden sich stellen, wenn Betroffene ein Recht zur Berichtigung nach Art. 16 DSGVO geltend machen und Änderungen für die Vergangenheit verlangen. Hier kann eine ältere Entscheidung des VG Düsseldorf vom 09.01.2008 (10 K 5154/05) helfen: Gestützt auf einen Berichtigungsantrag gem. § 20 BDSG verlangte eine Person nach erfolgter Geschlechtsumwandlung, alle Schriftstücke der Personalakte rückwirkend auf den neuen Vornamen und das neue Geschlecht anzupassen. Das Gericht lehnte dies ab, weil die Änderungen durch gerichtlichen Beschluss nach Maßgabe des Transsexuellengesetzes nur “ex nunc” und nicht “ex tunc” eingetreten seien. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Neuregelungen des PStG kann auf die Argumentation des VG Düsseldorf zurückgegriffen werden.
Derzeit keine Pflicht zur Nachfrage, aber…
Im Ergebnis ist zurzeit eine Teilentwarnung zu geben. Es besteht keine Pflicht, “blind” in den Betrieb hinein zu fragen. Die anstehenden gesetzlichen Änderungen sind aber im Blick zu halten, insbesondere angesichts möglicher Berichtigungsverlangen.

Counsel bei CMS Hasche Sigle (Düsseldorf)
Fragen an / Kontakt zum Autor? Die Autorenprofile in den sozialen Medien: Xing.

Senior Associate bei CMS Hasche Sigle (Leipzig)
Fragen an / Kontakt zum Autor? Die Autorenprofile in den sozialen Medien: Xing.