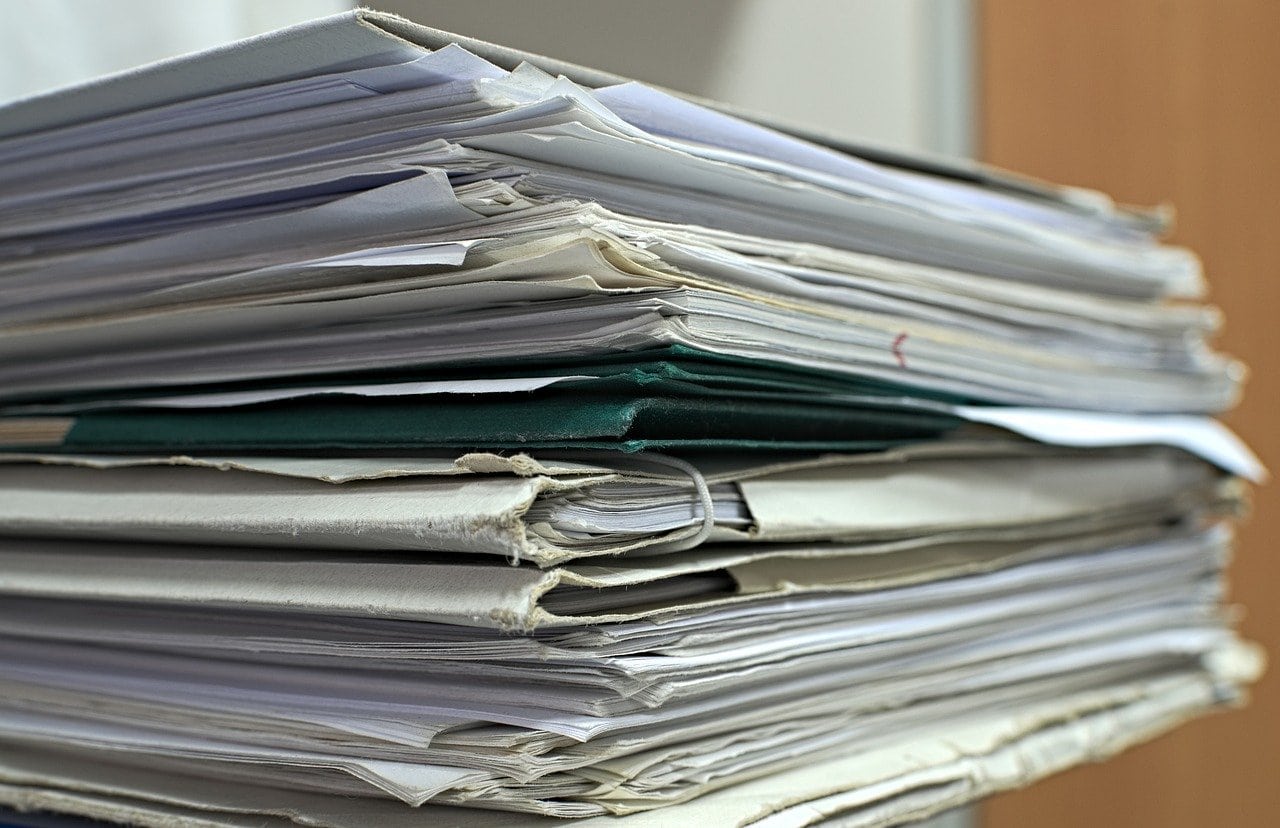Das Thema
Arbeitgeber, welche ein Arbeitsverhältnis aufgrund krankheitsbedingter Fehlzeiten beenden wollen, sind angehalten vor dem Ausspruch einer Kündigung ein sogenanntes betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen. In den letzten Jahren hat das BAG zahlreiche Entscheidungen rund um das BEM treffen müssen, vornehmlich zu Ablauf- und Verfahrensfragen in Bezug auf das BEM als auch zur Frage der Wirksamkeitsvoraussetzung eines BEM für eine Kündigung.
Mit seinem Urteil vom 15.12.2022 (2 AZR 162/22) klärte das BAG weitere bislang umstrittene Fragen, welche sich in diesem Fall zusätzlich auch noch mit der krankheitsbedingte Kündigung eines schwerbehinderten Mitarbeiters beschäftigten: Einerseits können Arbeitgeber die Einleitung eines BEM-Verfahrens nicht von der Unterzeichnung der Datenschutzerklärung durch den Arbeitnehmer abhängig machen. Auch vermag die Zustimmung des Integrationsamts (Kündigung schwerbehinderter Mitarbeiter) ein unterbliebenes BEM nicht ersetzen.
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM): Grundlagen
Gemeinsam mit dem Arbeitnehmer muss der Arbeitgeber bei einem BEM klären, welche Möglichkeiten bestehen, um die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden und einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Obgleich es sich bei der ordnungsgemäßen Durchführung des BEM um keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Kündigung handelt, ist eine Kündigung ohne oder fehlerhafter Durchführung des BEM faktisch nahezu immer unwirksam.
Kommt der Arbeitgeber seinen Pflicht nach § 167 II SGB IX nicht nach, muss er nach ständiger Rechtsprechung des BAG darlegen und beweisen, dass auch die Durchführung eines BEM nicht dazu hätte beitragen können, neuerlichen Arbeitsunfähigkeitszeiten entgegenzuwirken (BAG, Urteil vom 18.11.2021 – 2 AZR 138/21). Diese Umstände darzulegen, dürfte Arbeitgebern nur im Ausnahmefall gelingen. Eine Kündigung ist daher regelmäßig unverhältnismäßig und somit sozial ungerechtfertigt im Sinn von § 1 II KSchG.
Kündigung eines schwerbehinderten Menschen: Grundlagen
Nach § 168 SGB IX bedarf jede Kündigung eines schwerbehinderten Menschen der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes. Nach der Antragstellung holt das Integrationsamt Stellungnahmen ein und hört den schwerbehinderten Menschen an. Im Übrigen ist es bei der Bestimmung seiner Maßnahmen zur Entscheidungsfindung frei.
Insbesondere soll das Integrationsamt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hinwirken. Es entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen. Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Arbeitgeber die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären (§ 171 III SGB IX).
Der aktuelle Fall in Erfurt
Klägerin in dem hier zu betrachtenden Verfahren war eine mit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellte Arbeitnehmerin. Das Arbeitsverhältnis bestand bereits seit 20 Jahren. Die Arbeitnehmerin war in den letzten 5 Jahren ununterbrochen arbeitsunfähig erkrankt. Die Arbeitgeberin lud die Arbeitnehmerin daraufhin zu einem BEM-Gespräch ein und legte ihr mehrfach eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung vor.
Diese wollte die Arbeitnehmerin nicht unterzeichnen, woraufhin die Arbeitgeberin erklärte, dass das BEM unter diesen Umständen nicht durchgeführt werden könne. Kurz darauf beantragte die Arbeitgeberin die Zustimmung zur Kündigung beim Integrationsamt, welche ca. ein halbes Jahr später erteilt wurde. Die Arbeitgeberin kündigte das Arbeitsverhältnis und die Arbeitnehmerin erhob Kündigungsschutzklage.
Welche Schlüsselfragen galt es zu entscheiden?
Zum einen war fraglich, ob die beklagte Arbeitgeberin hinreichend ein BEM angeboten hatte bzw. die Durchführung des BEM von der Unterzeichnung der vorformulierten Datenschutzerklärung abhängig machen durfte. Lehnt ein Arbeitnehmer die Durchführung eines BEM ab, so ist das Verfahren grundsätzlich beendet und der erfolglose Versuch geht kündigungsrechtlich nicht zu Lasten des Arbeitgebers. Die Arbeitgeberin stellte sich auf den Standpunkt, die Arbeitnehmerin hätte die Durchführung abgelehnt als sie sich weigerte, die Datenschutzerklärung zu unterzeichnen. Die Klägerin meinte dagegen, dass es auf die Datenschutzerklärung nicht ankommen würde und sie im Übrigen sehr wohl gewillt war, am BEM teilzunehmen.
Zum anderen war umstritten, ob der Umstand, dass das Integrationsamt der Kündigung zugestimmt hatte, eine Vermutungswirkung dahingehend begründet, dass ein BEM die Kündigung nicht hätte verhindern können und daher kündigungsrechtlich „neutral“ zu beurteilen ist. Unterstellt diese Vermutung würde durchgreifen, so wäre die Kündigung jedenfalls nicht aufgrund eines unterlassenen oder fehlerhaften BEM unverhältnismäßig und sozial ungerechtfertigt.
Die Befürworter der Vermutungswirkung beriefen sich insbesondere auf eine Rechtsprechung des BAG aus dem Jahr 2006, wonach bei einer Zustimmung des Integrationsamtes zu einer Kündigung nur bei Vorliegen besonderer Anhaltspunkte davon ausgegangen werden könne, dass ein Präventionsverfahren nach § 167 I SGB IX eine Kündigung hätte verhindern können (BAG, Urteil vom 07.12.2006 – 2 AZR 182/06).
Auch wenn diese Entscheidung ein Präventionsverfahren betraf, sprach einiges dafür, die Grundsätze auch auf das BEM anzuwenden. Insbesondere besteht vor dem Integrationsamt ein umfassendes Verfahren, welches den Arbeitnehmer hinreichend schützen sollte. Das BEM als zusätzliches Verfahren wirkt dabei eher wie eine überflüssige Formalie, zumal es – anders als die Zustimmung des Integrationsamtes – gerade keine gesetzliche Wirksamkeitsvoraussetzung der Kündigung darstellt.
Entscheidung der Erfurter Richter: Kündigung unwirksam
1. Fehlende Datenschutzerklärung steht BEM nicht entgegen
In seiner neueren Entscheidung vom 15.12.2022 (2 AZR 162/22) stellte das BAG nunmehr fest, dass Arbeitgeber die Einleitung eines BEM-Verfahrens nicht von der Unterzeichnung der Datenschutzerklärung durch den Arbeitnehmer abhängig machen dürfen. § 167 II SGB IX sehe die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht als Voraussetzung für die Einleitung eines BEM vor und verpflichte den Arbeitgeber lediglich zu Hinweisen. Der Arbeitgeber müsse auch ohne datenschutzrechtliche Einwilligung mit einem BEM beginnen und dürfte aufgrund der Ablehnung des Arbeitnehmers hinsichtlich der Datenschutzerklärung nicht ohne Weiteres von einem Scheitern des BEM ausgehen.
2. Zustimmung des Integrationsamts ersetzt kein unterbliebenes BEM
Zudem entschied das BAG wie die Vorinstanz, dass die Zustimmung des Integrationsamts zu einer krankheitsbedingten Kündigung keine Vermutung begründet, dass ein BEM die Kündigung nicht hätte verhindern können. Eine Vermutungswirkung der Zustimmungsentscheidung des Integrationsamts finde im Wortlaut des § 167 II SGB IX keine Stütze.
Das BEM und das Verfahren vor dem Integrationsamt hätten zudem unterschiedliche Ziele, prozedurale Abläufe und Beteiligte. Während das BEM ist ein verlaufs- und ergebnisoffener Suchprozess sei, der individuell angepasste Lösungen zur Vermeidung zukünftiger Arbeitsunfähigkeit ermitteln soll und bei dem eine Vielzahl von Personen beteiligt werden (vgl. § 167 II SGB IX), überprüfe das Integrationsamt einen vom Arbeitgeber bereits gefassten Kündigungsentschluss (vgl. §§ 168 ff. SGB IX) und trifft eine Ermessensentscheidung, bei welcher das Interesse des Arbeitgebers an der Erhaltung seiner Gestaltungsmöglichkeiten gegen das Interesse des schwerbehinderten Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes abzuwägen ist.
Im Ergebnis blieb der Arbeitgeber daher darlegungs- und beweisbelastet dafür, dass das unterlassene BEM nicht dazu hätte beitragen können, neuerliche Krankheitszeiten zumindest zu vermindern und so das Arbeitsverhältnis zu erhalten. Dem kam der Arbeitgeber nicht nach. Die Kündigung war daher unverhältnismäßig und somit sozial ungerechtfertigt (§ 1 II 1 KSchG).
Bewertung und Handlungsempfehlungen für die Praxis
Die Annahme, ein BEM sei nicht bereits deshalb gescheitert, weil ein Arbeitnehmer die Datenschutzerklärung nicht unterzeichnen wolle, bestätigt die hohen Anforderungen, welche die Rechtsprechung an ein Scheitern des BEM stellt. Obgleich dieser Umstand die Einleitung und Durchführung des Verfahrens für den Arbeitgeber verkomplizieren kann, ist anzuraten, nicht vorschnell ein Scheitern des Verfahrens anzunehmen.
Auch soweit das BAG davon ausgeht, dass die Zustimmung des Integrationsamtes keine Vermutungswirkung hinsichtlich eines (unterlassenen) BEM begründet, ist die rechtliche Begründung grundsätzlich nachvollziehbar. Aufgrund der unterschiedlichen Schutzrichtungen und mangels gesetzlicher Anknüpfung ist eine mittelbare Verknüpfung der grundsätzlich getrennten Verfahren nicht angezeigt.
Verkommt das BEM zur Formalität?
Das Ergebnis ist für Arbeitgeber dennoch misslich, denn es verkompliziert die Einhaltung des rechtlich zwingend einzuhaltenden Verfahrens. Mehr denn je ist dabei ein besonderes Augenmerk auf die Timeline zu setzen. Bekanntermaßen hat ein BEM kein „Mindesthaltbarkeitsdatum“ (BAG, Urteil vom 18.11.2021 – 2 AZR 138/21). Je nach Sachlage vergehen bis zu einer Entscheidung des Integrationsamtes mehrere Monate/Jahre. Ergeht sodann die ersehnte Entscheidung des Integrationsamtes, hat ein zuvor bereits durchgeführtes BEM wohlmöglich keinen Bestand mehr.
Der Arbeitgeber kann ab Zugang der Entscheidung nur innerhalb eines Monats kündigen und muss in Windeseile erneut ein BEM einleiten. Eine ordnungsgemäße und dem Arbeitnehmer dienliche Durchführung eines BEM innerhalb weniger Tage ist praxisfern. Wird das BEM nicht ordnungsgemäß durchgeführt, geht der Arbeitgeber Prozessrisiken ein. Vergeht der Monat nach der Zustellung des Zustimmungsbescheides, ohne dass der Arbeitgeber kündigt, so müsste der Arbeitgeber einen neuen Antrag auf Zustimmung gegenüber dem Integrationsamt stellen und verliert mithin Zeit. Dieses Ergebnis ist nicht überzeugend und dürfte einmal mehr dazu führen, dass das BEM als Formalität verkommt. Ob in diesen Fällen durch die kumulierenden Verfahren tatsächlich ein höheres Schutzniveau für den Arbeitnehmer erreicht wird, ist durchaus fraglich.
Arbeitgebern ist daher zu raten, sich bei der gemeinsamen Durchführung der Verfahren beraten zu lassen. Nur bei stringenter Beachtung der geltenden Regelungen und einem exakten Timing lassen sich Prozessrisiken in einem wohlmöglich folgenden Kündigungsschutzverfahren im Vorfeld reduzieren.